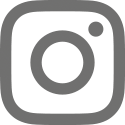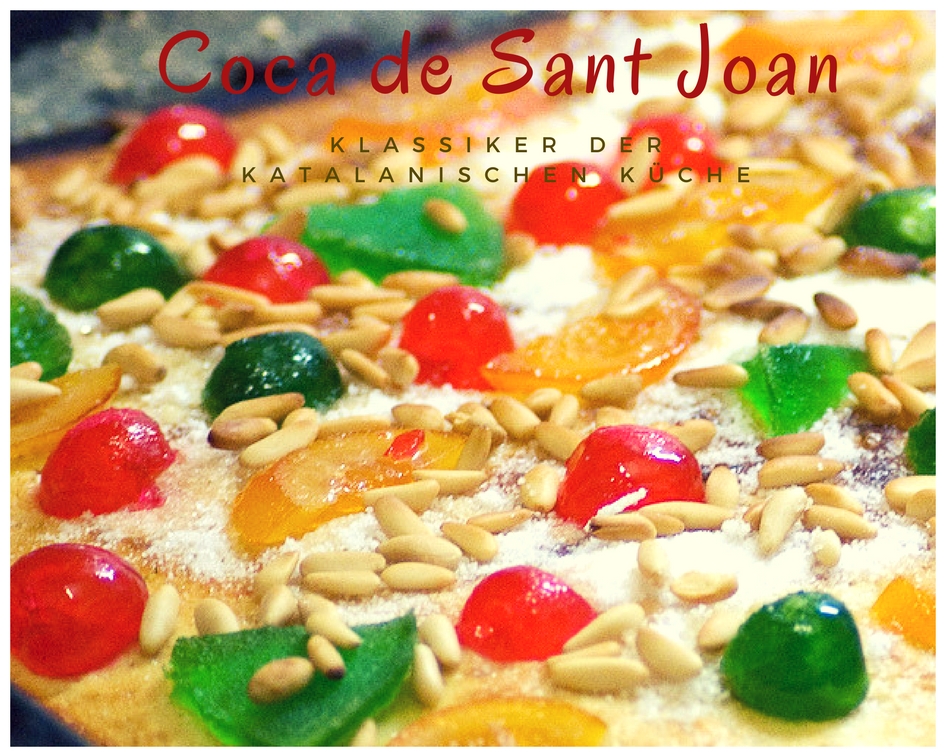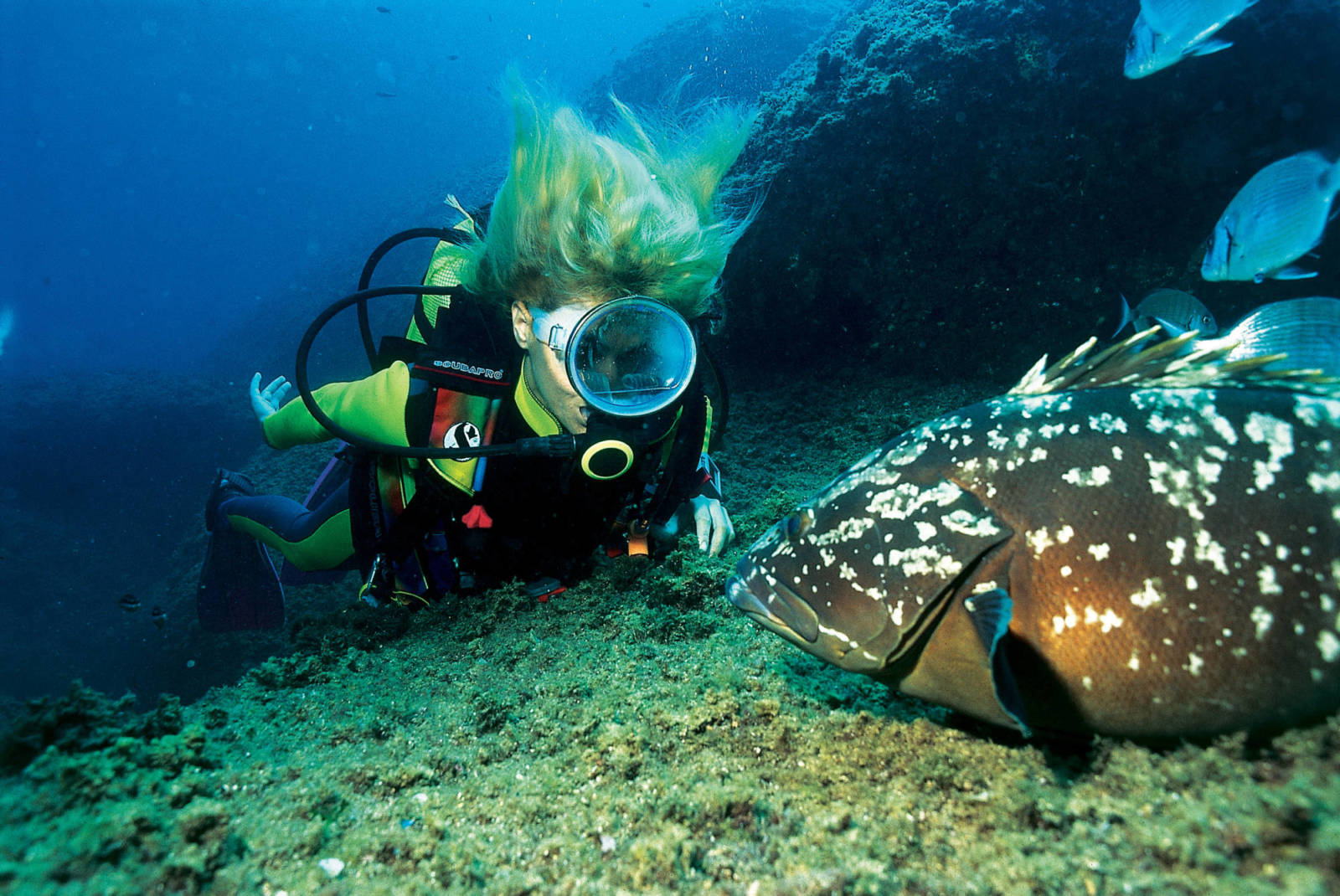Die Provinz Lleida ist berühmt für ihre facettenreiche Natur, für die atemberaubende Schönheit ihrer Pyrenäentäler und faszinierende Hochgebirgslandschaften, die in weiten Teilen im Nationalpark Aigüestortes i Estany de Sant Maurici unter Schutz stehen. Bei so viel natürlicher Schönheit treten die kulturellen Glanzpunkte Lleidas schon einmal in den Hintergrund. Zu Unrecht! Wir stellen Ihnen heute die Top 10 der Provinzhauptstadt Lleida vor. Denn eins ist sicher: Die alte Stadt am Rio Segre verdient durchaus einen Besuch.
Die alte Kathedrale, Seu Vella
Wer Lleida kennenlernen möchte, beginnt am besten an Lleidas alter Kathedrale, der Seu Vella. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und gleichzeitig einer der besten Aussichtspunkte über Lleida und den Landkreis Segrià. Die hervorragende Sicht gab dem Hügel seit jeher strategische Bedeutung in der Siedlungsgeschichte des Landes. Es ist hochwahrscheinlich, dass unter den alten Mauern der Seu Vella nicht nur die Reste der alten maurischen Stadt Lárida ruhen, sondern auch die des römischen Ilderda und der iberischen Stadt Iltirta.
Im Gegensatz zu anderen Kathedralen ist die Seu Vella deshalb auch nicht nur ein Sakrales Kunstwerk, sondern auch Teil einer Festung, die neben der Kathedrale auch die „La Suda“ genannte Burg Castell del Rei und eine militärische Festung mit Mauern, Bollwerken, Wehrgängen und Tunneln umfasst.
Dennoch, mit ihrem charakteristischen Glockenturm, dem beeindruckenden Kreuzgang und der gotischen Basilika gilt die Seu Vella als einer der Höhepunkte sakraler katalanischer Architektur des 13. Jahrhunderts. Lleidas alte Kathedrale beherbergt die Gräber zahlreicher adeliger Familien und bedeutender Persönlichkeiten in ihren Kapellen. Reste alter Wandmalereien und Werke der Plastischen Kunst, die in Nischen, Deckengesimsen und Türen erhalten geblieben sind, geben Zeugnis vom ursprünglichen künstlerischen Reichtum der Kathedrale.
Diese wurde jedoch im 17. Jahrhundert während des Els Segadors-Krieges zum Krankenhaus und Waffenlager umfunktioniert und um 1707 von Felipe V zum Militärquartier deklariert. Diese Funktion hatte die Kathedrale noch bis 1948 inne, seitdem wird sie Schritt für Schritt restauriert. Weitgehend ungeschmückte Kirchenschiffe und die einst zur Bekämpfung von Seuchen weiß gekalkten Wänden der Kathedrale erinnern bis heute an die Jahrhunderte militärischer Nutzung.

Der Kreuzgang von La Seu Vella, dem Wahrzeichen der Stadt Lleida © Oriol Clavera
Castell del Rei – La Suda: Die Königsburg
Als mächtiger Wächter über die Stadt erhebt sich das Königsschloss Castell del Rey am höchsten Punkt des Hügels. Sein volkstümlicher Name „La Suda“, bedeutet im Arabischen „geschlossenes Stadtgebiet“. Er erinnert an die Vorläuferin des Castell del Rei, eine im 9. Jahrhundert erbaute maurische Festung; historische Quellen belegen jedoch, dass La Suda auch der Name des Adelsviertels war, das sich über den Hügel erstreckte.
Wie der Name Castell del Rei nahelegt, residierte hier der Monarch während seiner Aufenthalte in Lleida. Zwischen dem Ende des 13. und 14. Jahrhundert erbaut, vereinigt die Burg in sich Elemente romanischer und gotischer Architektur. Ihre alten Mauern sind Zeugen historischer Ereignisse, welche die Geschichte Kataloniens und ganz Spaniens beeinfluss haben. Hier suchte einst der letzte Kalif von Córdoba Zuflucht, hier fand die Heirat von Ramón Berenguer IV und Petronila de Aragón statt, welche die Geburtsstunde des Königreichs von Aragón war, hier schwor der katalanische Adel dem damals gerade sechsjährigen Jaume I, el Conqueridor (Jakob I, der Eroberer) die Treue, der später zum katalanische Volkshelden wurde.
Seit 2011 kann man die Geschichte der Burg anhand von Informationstafeln und audiovisueller Installationen im Informationszentrum in der Sala Real (Königssaal) nachvollziehen. Unverzichtbar ist auch ein Besuch des Aussichtspunktes auf der Terrasse, der als höchstgelegener Punkt Lleidas einen perfekten Überblick über die ganze Stadt ermöglicht. Im Gegensatz zum Glockenturm der Kathedrale ist dieser Dank des neuen Aufzuges an der Nordseite des Hügels auch für mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich.

La Suda – Lleidas alte Festung © Miguel Raurich
Das Museum von Lleida – Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Viele der Kunstschätze aus dem Castell del Rei und der Seu Vella befinden sich heute im Museum von Lleida. Dieses beherbergt auf einer Ausstellungsfläche von 7000m2 unterschiedlichste Ausstellungsstücke, die es erlauben, einen geschichtlichen Bogen aus der prähistorischen Epoche der Region bis in die Gegenwart zu schlagen.
Das 2007 neu eröffnete Museum führt zwei der bedeutedsten Sammlungen Lleidas zusammen, nämlich die des ehemaligen Diözesanmusums und die archäologische Sammlung des Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Unter den 974 Kunstwerken und archäologischen Ausstellungsstücken sind diejenigen aus der Bronzezeit sowie aus der iberischen und römischen Epoche besonders hervorzuheben. Besonders beeindruckend ist auch das Ensemble von Bovalar aus westgotischer Zeit, dessen berühmtestes Stück ein frühchristliches Taufbecken aus dem 8. Jahrhundert ist.
Weitere bemerkenswerte Ausstellungsstücke, in welchen die bewegte (Kultur-)Geschichte fassbar wird, sind zum Beispiel ein Schachspiel aus Bergkristall aus dem 11. Jahrhundert, die Altarbilder aus der romanischen Epoche, die Steinskulpturen aus der Seu Vella, die Wandmalereien der Pia Almoina, die gotische Malerei aus dem Atelier der Herrero, Skulpturen der Leridaner-Schule aus dem 14. Jahrhundert, flämische Wandteppiche und ein Gewand von Papst Kalixt III.

Christus von Perves (18. Jahrhundert) im Museu de Lleida Diocesà i Comarcal © Imagen M.A.S.
Die Kirche Sant Llorenç – Església Sant Llorenç
Die Kirche Sant Llorenç ist nach der Seu Vella die zweitbedeutendste Kirche von Lleida. Erbaut im romanischen Stil mit gotischen Erweiterungen, beeindruckt sie mit drei gleich hohen Kirchenschiffen und drei Absiden. Der Bau von Sant Llorenç begann im 12. Jahrhundert und lag in den Händen von Künstlern und Handwerksmeistern, die mit Pere Coma, dem Meister der Seu Vella gearbeitet hatten. So ist das Mittelschiff noch im romanischen Stil gehalten, während die beiden Seitenschiffe, die Seitenkapellen und der achteckige Glockenturm wesentlich später errichtet wurden und bereits der Gotik zuzurechnen sind. Vier bedeutende Altarbilder sind in Sant Llorenç erhalten. Sie sind Sant Llorenç, Santa Úrsula, Sant Pere und Sant Llúcia gewidmet. Darüber hinaus beherbergt Sant Llorenç verschiedene Kunstwerke, die dem Diözesanmuseum von Lleida gehören.
Besonders bemerkenswert ist die Skulptur der Heiligen Jungfrau Verge dels Fillols, die urpsrünglich in der Seu Vella stand und Santa María de la Candelera, ein Gemälde im gotischen Stil aus dem 15. Jahrhundert, das dem Maler Mateu Ferrer zugeschrieben wird. Sant Llorenç beherbergt auch das Grab von Ramon de Tárrega, eines konvertierten Juden und späteren Dominikanermönches, der in Konflikt mit der Inquisition geriet.

Mittelschiff und Altar von Sant Llorenç © Miguel Raurich
Die Templer Festung Gardeny – Castell Templer de Gardeny
Nachdem die Templer im Jahr 1149 Ramón Berenguer IV tatkräftige Unterstützung bei der Eroberung des maurisch besetzten Lleida geleistet hatten, erhielt ihr Orden zum Dank u.a. den Gardeny-Hügel. Er ist der zweite Hügel Lleidas, der seit jeher als militärisch-strategischer Stützpunkt gedient hatte. 1156 wird der erste Prior von Gardeny, fray Pere de Cartellà, erstmals urkundlich erwähnt. Um diese Zeit beginnt der Bau der Gardeny-Festung, die nicht allein eine Burg, sondern ein ganzer Gebäudekomplex ist und als eine der bedeutendsten Repräsentationen der Templer-Architektur in Katalonien gilt. Von Mauern umgeben sind hier bis heute einige Wachttürme und Bollwerke, der Wohnturm, die romanische Kirche Santa Maria de Gardeny und der Burgfried erhalten, die um einen zentralen Innenhof angeordnet waren.
Der Wohnturm ist eine solide, zweistöckige Konstruktion, die in mehrere Bereiche aufgeteilt ist: Lagerräume, Wohnbereiche und ein an den Wohnturm angelehnter Burgfried.
Die alte romanische Kirche ist zwar in weiten Teilen zerstört, jedoch insofern besonders interessant, als in ihrem Inneren Wandmalereien der Templer erhalten sind.
Im Besucherzentrum Ordre del Temple kann man Dank Computeranimationen nachvollziehen, wie die architektonischen Strukturen seinerzeit ausgesehen haben und sich ein Bild von den Elementen machen, die heute verschwunden sind. So wird die beeindruckende Größe der ursprünglichen Festung noch besser nachvollziehbar.

Santa Maria de Gardeny – Romanische Kirche im Castell de Gardeny © Juan José Pascual
Das historische Rathaus – Palau de la Paeria
Der Palau de la Paeria ist Sitz der Stadtverwaltung von Lleida und schon sein Name hat eine interessante Geschichte. „Paer“ geht auf das lateinische Wort „patiarium“ zurück, das „Mann des Friedens“ bedeutet. Die Paeria von Lleida ist der Sitz des Bürgermeisters, und damit des Chefs der „paers“. Der besondere Titel dieses Amtes, den es nur in Lleida und Cervera gibt, geht auf Privilegien zurück, die Jaume I den damaligen Konsulen Lleidas gewährte.
Der Palast verfügt über zwei verschiedene Fassaden: Die im romanischen Stil zeigt zur plaça Paeria und die andere im neoklassizistischen Stil mit neumittelalterlicher Umgestaltung aus dem Jahr 1929 zeigt zum Fluss Segre. Das Gebäude erhebt sich über mehreren architektonischen Schichten, welche Experten der Stadt und der Universität von Lleida im Rahmen mehrerer Ausgrabungen ans Tageslicht gebracht haben.
Erbaut im 12. Jahrhundert, wurde der Palast im Jahr 1383 von seinen Besitzern, der Familie Sanaüja, als zukünftiger Rathaussitz an die Stadt Lleida übertragen. Der Palau de la Paeria gilt als eines der repräsentativsten Werke ziviler romanischer Architketur in Lleida und darüber hinaus als eines der bemerkenswertesten Monumente Kataloniens. Heut zu Tage erfüllt er weiterhin seine Funktion als Rathaus und beherbergt einige faszinierende Kunstschätze, die eng mit der Geschichte der Stadt verbunden sind.

Innenhof des Palau de la Paeria © Miguel Raurich
Die neue Kathedrale – La Catedral Nova
Lleidas neue Kathedrale ist im Barockstil erbaut, weist aber auch starke Einflüsse des französischen Klassizismus auf. Sie wurde zwischen 1761 und 1781 erbaut und befindet sich im Gegensatz zur alten Kathedrale mitten im Stadtzentrum. Das Wappen der Bourbonen ziert den Haupteingang, im Inneren der dreischiffigen Kirche fallen besonders die zarten, korinthisch inspirierten Säulen auf, welche die Rundbögen stützen. Der barocke Altarraum, ein Werk von Lluís Bonifas Massó, wurde während des Bürgerkriegs im Jahr 1936 zerstört. Die neue Kathedrale beherbergt auch bemerkenswerte Darstellungen der Heiligen Jungfrau: Zum einen ein Abbild der Verge del Montserrat (la Moreneta), ein Werk von Josep Obiols und zum anderen die Verge del Blau, zu deutsch, die „Jungfrau mit dem blauen Fleck“. Diesen verdankt sie der Legende nach einem Hammerwurf gegen die Stirn, zu welchem sich ihr Urheber hinreißen ließ. Der Grund: Während dieser auf Reisen war, hatte sein Gehilfe die Skulptur fertiggestellt, und dabei weit mehr Kunstfertigkeit gezeigt, als sein Meister jemals erreicht hatte.

Catedral Nova de Lleida © Juan José Pascual
Der Modernisme in Lleida
Lleida beherbergt eine ganze Reihe von Gebäuden, die wunderbar die Architektur des katalanischen Modernismus repräsentieren. In den letzten Jahren wurden viele von ihnen renoviert und erstrahlen nun wieder in ihrem ursprünglichen Glanz. So zum Beispiel das Teatre Municipal de l’Excorxador am C/ Lluís Companys, s/n, welches als bedeutendstes architektonisches Ensemble des Modernismus von Lleida gilt. Entworfen vom Architekten Francesc de Paula Morera i Gatell, zählt das Theater inzwischen zum industriellen Erbe der Stadt. Seit 1984 ist es aufwendig renoviert worden und istnun zu einer der wichtigsten Kulturschauplätze Lleidas. Weitere sehenswerte Beispiele für modernistische Architektur in Lleida sind zum Beispiel die Häuser 74 und 76 im Einkaufszentrum Carrer Major, deren charakteristische Elemente gewölbte Balkone, aufwendig gestaltete Fenster und ein florales Dekor sind sowie die frisch renovierte Casa Morera auf der Av. Blondel, die als eine der besonders originellen Repräsentationen des katalanischen Modernisme gilt.

Modernistisch von außen, modern von Innen: Teatre Municipal de l’Escorxador © Oriol Llauradó
Die Geheimnisse der Stadt entdecken: Die archäologische Route „Lleida Secreta“
Die archäologische Route Lleida Secreta erlaubt dem Besucher, die verborgenen Spuren der römischen und mittelalterlichen Epoche der alten Stadt zu entdecken. Die Reste alter Stadtmauern, maurische Bäder und selbst das mittelalterliche Gefängnis haben den Wandel der Zeiten im Verborgenen überdauert. Die von Turisme Lleida geschaffene archäologische Route führt den Besucher im wörtlichen Sinne unter die Oberfläche der Lleidaner Architektur. Das Auditori Municipal Enric Granados mit übereinanderliegenden Schichten aus spätiberischer, römischer, mittelalterlicher und moderner Epoche ist nur eines der beeindruckenden Beispiele, für den archäologischen und kulturgeschichtlichen Reichtum der Stadt, der auf dieser Route erschlossen wird.

Die mittelalterliche Stadtmauer von Lleida an der Seu Vella © Miguel Raurich
Parks, Gärten und Naturschutzgebiete
Lleida bietet nicht nur reichlich Kultur, sondern auch wunderbare Möglichkeiten, Natur in der Stadt zu erleben, zum Beispiel im Grüngürtel „La huerta“, dessen Gärten und Felder die Stadt umgeben. Wie geschaffen, um die Seele baumeln zu lassen sind auch grüne Oasen wie der Flusspark am Segre und der Park Els Camps Elisis mit den vielen Skulpturen und romantischen Gebäuden.
Wer noch ein bisschen tiefer in die Natur eintauchen möchte, besucht La Mitjana, ein 90 Hektar großes Feuchtgebiet mit schattigen Flusswäldern, in dem verschiedenste Vogelarten einen Lebensraum gefunden haben. Für Freunde der Botanik ist ein Besuch im Arborètum unverzichtbar. Der botanische Garten ist insbesondere den für verschiedene Klimazonen typischen Waldformen gewidmet und beherbergt auf auf 7 Hektar Fläche etwa 1000 unterschiedliche Pflanzenarten.

Park Els Camps Elisis in Lleida © Miguel Raurich